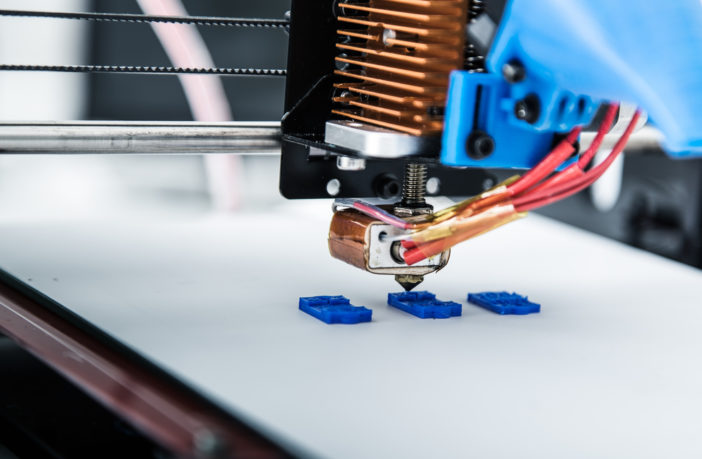Der 3D-Druck gewinnt in der industriellen Fertigung zunehmend an Beliebtheit. Weltweit steht die vergleichsweise neuartige Technologie im Fokus, vor allem aufgrund ihrer vielseitigen Einsatzmöglichkeiten in Bereichen wie dem Gesundheitswesen oder der Luftfahrt – bis hin zur Sportartikelindustrie. „Sie kann ihr Potenzial überall entfalten”, ist Yann Ménière, Chefökonom des Europäischen Patentamts, sich sicher.
Gerade dieses Jahr stellte der 3D-Druck seinen Wert während der Corona-Pandemie unter Beweis, als besonders in norditalienischen Notstandsgebieten die Beatmungsgeräte knapp wurden “3-D-Druck hat in der Lombardei Covid-Patienten gerettet”, so der Mitarbeiter der EPA. Per 3D-Druck wurden die Ventile defekter Beatmungsgeräte ersetzt, herkömmliche Taucherbrillen wurden durch 3D-Spezialfertigungen zu Beatmungsmasken umfunktioniert. “Additive Fertigung war schneller als die herkömmliche Industrie, gebrochene Lieferketten wurden übersprungen”, erklärt Yann Ménière die Situation.
Deutsche Großkonzerne melden die meisten 3D-Patente an
Er bestätigt aus erster Hand die zunehmende Beliebtheit der Technik. Schon seit 2015 steigt die Zahl der Patentanmeldungen im Schnitt jährlich um 36 Prozent, wie eine Studie der EPA belegt. Das ist ein Zehnfaches dessen, was Patentersuche sonst an Anstieg verzeichnen – üblich ist ein Wachstum von lediglich 3,5 Prozent pro Jahr. Vielversprechend ist dabei vor allem aus europäischer Sicht, dass die EU in Sachen additiver Fertigung, wie 3D-Druck auch genannt wird, bisher eindeutig den Ton angibt. Sonst führende Patentmächte wie Südkorea oder China spielen in dieser Kategorie bisher kaum eine Rolle.
Seit 2010 meldeten vor allem deutsche Konzerne wie BASF oder Siemens mehr als 3000 Patente aus dem Bereich 3D-Druck-Technik an. Das entspricht fast der Hälfte der EU-weiten Erfindungen und einem Fünftel der globalen Patentanmeldungen beim EPA.
Europa als Innovationszentrum
”Der Anmeldezuwachs in der additiven Fertigung ist Teil des Booms digitaler Technologien insgesamt und bestätigt, dass sich die digitale Transformation der Wirtschaft unverkennbar in den beim EPA eingereichten Patentanmeldungen widerspiegelt”, erklärt EPA Präsident António Campinos. Dem Chef des europäischen Patentamts zufolge ändere es die grundlegenden Spielregeln der weltweiten Wirtschaft, wenn keine Notwendigkeit mehr besteht, Produkte in fernen Ländern herzustellen und über weite Strecken zum Endkunden zu transportieren.
Zwar sei die Technologie bisher noch zu teuer für Massenproduktionen im industriellen Maßstab, doch auch daran werde geforscht – mit Europa als Zentrum der Innovation. Getragen wird die Forschung vor allem von deutschen Firmen.
Woher kommen die meisten Patente für 3D-Druck?
Fast jede zweite aller Patentanmeldungen beim EPA zur additiven Technik ging in den letzten zehn Jahren auf ein europäisches Unternehmen zurück. Vorangetrieben wurde der Fortschritt vor allem von deutschen Firmen, ebenso wie von patentaktiven Forschungszentren wie der Fraunhofer-Gesellschaft. Diese erließ insgesamt 3155 Schutzersuche in dieser Zeitspanne. Europaweit zählt das europäische Patentamt insgesamt 15 Innovationszentren für additive Technik. An der Spitze stehen München, Berlin, Barcelona und Zürich, wobei besonders München eine Sonderstellung zukommt.
Die bayrische Hauptstadt dient gleich mehreren Technologietreibern als Sitz; neben Siemens im Anwendungsbereich der Medizintechnik haben auch der Triebwerkshersteller MTU und der 3D-Spezialist Eos ihren Hauptsitz im Münchner Vorort Krailling.
Medizin- und Automobilbranche setzen auf 3D-Druck
Wenn nicht gerade im Rahmen einer Pandemie Notfall-Beatmungsgeräte produziert werden müssen, wird der 3D-Druck im medizinischen Bereich vordergründig für Implantate und individuell maßgeschneiderte Prothesen genutzt. Durch die millimetergenaue, schichtweise Fertigung wird für die Implantate nicht nur weniger Material benötigt, auch die Passgenauigkeit konnte so deutlich verbessert werden. Sogar erste Prototypen für 3D-gedruckte Organe, wie beispielsweise menschliche Herzen, wurden bereits getestet. Und auch in der Industrie werden mehr und mehr Teile am Computer entworfen und mit additiver Technik verwirklicht.
Oft sind diese Spezialanfertigungen und Prototypen so einzigartig, dass sie durch herkömmliche Verfahren mittels Werkzeugmaschinen kaum gebaut werden können. Dadurch können neue Eigenschaften ermöglicht, das Gewicht reduziert und die Fertigkeit erhöht werden. So wird der 3D-Druck im Automobilbau beispielsweise in der Prototypenfertigung eingesetzt und damit Entwicklungszeiten stark verkürzt. Gerade mit einem Druck auf Aluminium können in kurzer Zeit komplexe Bauteile geschaffen werden, die auch hoher mechanischer und dynamischer Belastung standhalten. Und auch Sportartikel-Hersteller wie Adidas oder Nike experimentieren schon seit Jahren mit Sportschuhen aus dem 3D-Drucker.